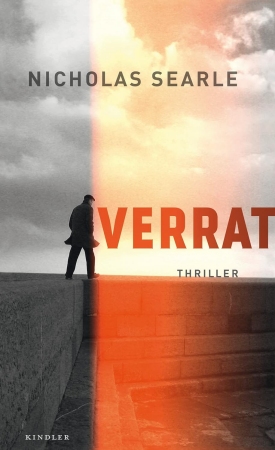© JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH & Co. KG www.jungefreiheit.de 51/23 / 15. Dezember 2023
Verborgen hinter Mauern
Irland: Die einst machtvolle Rolle der Katholischen Kirche erfährt eine schmerzvolle Aufarbeitung
Daniel Körtel
Vor allem Nordirlands Überlebende der vom katholischen Nonnenorden betriebenen Mutter- und Kind-Heime (Mother and Child Homes) geben keine Ruhe. „Wir fühlen uns von allen im Stich gelassen, von der britischen Regierung und dem Exekutivbüro bis hin zu den Politikern und Beamten“, erklärte Adele Johnstone, Sprecherin von „Birthmothers and their Children for Justice NI“, im Oktober gegenüber der BBC. „Birth Mother‘s and their Children for Justice“ wurde im August 2015 gegründet. Es ist eine Gruppe von Müttern und Kindern, die sich für Gerechtigkeit für die Betroffenen der Mutter- und Kind-Einrichtungen/Magdalenen-Wäschereien/Arbeitshäuser im Norden Irlands einsetzt.
„Im Oktober 2021 wurden so viele Versprechungen gemacht und wir waren voller Hoffnung, daß sich die Dinge endlich ändern würden. Jetzt, zwei Jahre später, haben wir noch nicht einmal das Mandat für eine Untersuchung und keinen Cent an Entschädigung“, fuhr Johnstone fort. Barbara McCann, die 1962 adoptiert wurde, schlug in die gleiche Kerbe: „Beratungs- und andere Unterstützungsdienste sind großartig und natürlich zu begrüßen, aber wir brauchen mehr als Tee und Mitleid. Nach all den Jahren der Kampagnenarbeit brauchen wir die versprochene gesetzliche Untersuchung. Die Forschung wurde durchgeführt, wir haben die Berichte gelesen, die Überlebenden müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist – viele von ihnen sind gebrechlich und alt.“
Den Anstoß für diese Debatte hatten die 2013 publik gewordenen Nachforschungen der Lokalhistorikerin Catherine Corless über das von den Schwestern der Bon Secours im westirischen Tuam betriebene Mother and Child Home geliefert. Die folgenden Untersuchungen deckten auf, daß in den Jahren 1926 bis 1961, in denen der Orden das Heim betrieb, fast 800 Kinder verstarben, entsorgt wie Müll in einer Klärgrube auf dem Heimgelände.
In dem Irland dieser Vergangenheit hatte kaum jemand ein schwereres Stigma zu ertragen als unverheiratete Frauen, die schwanger wurden. Die noch aus dem viktorianischen Zeitalter überkommenen Moralvorstellungen, mit denen die britische Oberherrschaft auch in Irland die Zahl illegitimen Nachwuchses zu reduzieren versuchte, waren nach 1922 mit der Unabhängigkeit Irlands immer noch tief in der Gesellschaft verankert.
Nach der Geburt wurden die Kinder von ihren Mütter getrennt
Für eine ledige Schwangere gab es keinen anderen Platz als in den Heimen – oftmals auf Initiative des Pfarrers oder der Polizei –, denn in den Familien galten die „gefallenen Frauen“ als Schande, während die Väter wiederum feige die Flucht in die Emigration suchten oder die Vaterschaft schlicht leugneten. Nicht wenige dieser aus der Mittel- und Unterschicht stammenden Frauen waren die Opfer von Vergewaltigung und Inzest. In den wie Gefängnissen betriebenen Heimen fanden die Frauen allerdings keine liebevolle Fürsorge, sondern grobe Mißachtung und harte Strafen durch die Nonnen. Nach der Geburt wurden die Kinder oftmals gegen ihren Willen von ihren Müttern getrennt und nach einiger Zeit legal wie illegal zur Adoption freigegeben, ausschließlich in katholische Familien in Irland, Großbritannien und den USA.
In Tuam, das als eine der schlimmsten Einrichtungen der neun in Irland betriebenen Heime gilt, verblieben die Mütter von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren, bevor sie in niedere Arbeitsstellungen außerhalb vermittelt wurden. Nur in den wenigsten Fällen konnten sie ihre Kinder mitnehmen. In der Regel kamen diese mit sieben oder acht Jahren in gesonderte Einrichtungen.
Auffallend ist die hohe Sterblichkeitsrate unter den in den Heimen lebenden Kindern. In Tuam konnte sie aufgrund lückenhafter Statistiken nur geschätzt werden, doch liegt diese Zahl mit 35 Prozent weit über der in vergleichbaren Einrichtungen wie sie im benachbarten Wales und England bestanden. Als ursächlich wird hierfür die Vernachlässigung durch die Nonnen und das Fehlen ärztlicher Hilfe angenommen.
Aber auch nach den Mother and Baby Homes konnte das System die Frauen im Griff behalten. Ihrem Aufenthalt dort konnte sich der in den als Magdalene Laundries bezeichneten Einrichtungen anschließen, etwa zehn von Nonnenorden betriebenen Wäschereien, in denen die „gefallenen Frauen“ auf unbestimmte Zeit Zwangsarbeit leisten mußten. Die letzte dieser Wäschereien, die Our Lady of Charity in Dublin, wurde erst 1996 geschlossen, drei Jahre nach der Entdeckung von 155 nicht gekennzeichneten Gräbern auf dem Gelände, Überreste von dort einsitzenden Frauen und Mädchen.
Eine Änderung trat mit dem 1953 in Kraft getretenen Adoption Act ein, der erstmals Adoptionen legalisierte und den die Heime betreibenden Nonnenorden ein Goldenes Zeitalter bescherte. Es kam eine lukrative Adoptionsindustrie in Gang. Was vorher im verborgenen auf einem grauen Markt betrieben wurde, erhielt nun einen legalen Anstrich.
Anfang der 1970er Jahre fand dieses System jedoch ein rasches Ende. Ausschlaggebend waren zum einen die deutlich zurückgegangenen Berufungen für die Klöster im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und der einsetzende gesellschaftliche Wandel, der unverheirateten Schwangeren zunehmend den Makel nahm.
Doch das Ende der Mother and Baby Homes und der Adoptionsindustrie bedeutet nicht das Ende des Leids für die Betroffenen. Noch immer sind viele von denen, die als Kinder ihren alleinstehenden Müttern entrissen wurden, auf der Suche nach ihren Wurzeln. Immerhin als einen wichtigen Schritt in der Aufarbeitung hat Papst Franziskus auf seiner Irland-Visite 2018 öffentlich erklärt, daß die Katholische Kirche die Schwangerschaft einer alleinstehenden Frau nicht mehr als Todsünde betrachtet.
Doch damit ist die Aufarbeitung des Machtmißbrauchs der Kirche und des wider besseres Wissen um die Mißstände in den Heimen sie deckenden Staates keineswegs abgeschlossen. Viele Akten sind noch unter Verschluß, und eine geplante Gedenkstätte läßt auf sich warten. Wissenschaftler beklagen die Blockadehaltung der Behörden beim Zugang zu staatlichen Archiven. Dabei richtet sich der Fingerzeig nicht allein auf Kirche und Staat, sondern auch auf eine Gesellschaft, die das lästige Problem der ledigen Mütter bequem hinter hohen Mauern verschwinden lassen wollte. Was sich jedoch dahinter an Dramen abspielte, war durchaus nicht wenigen bekannt.
Eine der kompliziertesten Exhumierungen der Welt
Die Auflösung kirchlicher Machtverhältnisse hat indessen auch die Justiz in späte Bewegung versetzt. Hierfür steht der Fall eines 87jährigen, früheren Lehrers der Laienorganisation der Christian Brothers, den im Oktober ein Gericht in Dublin wegen seiner teils bizarren sexuellen Übergriffe auf männliche Schüler in den 1970er und 1980er Jahren zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte. Der sich schuldig bekennende Täter sitzt bereits wegen ähnlicher Fälle im Gefängnis.
Unterdessen hat der mit der Identifizierung der Babyleichen von Tuam beauftragte Forensiker Daniel Mac Sweeney einen ersten Zwischenbericht abgegeben. Das Alter der Überreste und die Bedingungen, unter denen sie lagen, bringe das Verfahren an die „Grenzen der Wissenschaft“. Viele der Überreste könnten sehr wahrscheinlich nicht identifiziert werden.
Roderic O’Gorman, Minister für Kinder, Gleichstellung, Behinderte, Integration und Jugend bezeichnete die Exhumierung als „eine der kompliziertesten forensischen Ausgrabungen der Welt“.
Denn die Leichen von Hunderten von Säuglingen, die im Heim an verschiedenen Krankheiten gestorben waren, wurden laut BBC in Tücher eingewickelt und in die Kammern eines stillgelegten Abwassersystems auf der Rückseite des ehemaligen Arbeitshauses gelegt, das längst abgerissen und mit einer Wohnsiedlung und einem Spielplatz bebaut worden sei.